
Milan Kundera:
Die Unsterblichkeit
Roman, dt. München, Wien 1990
FT 12409 416 S.
gelesen Dezember 1994
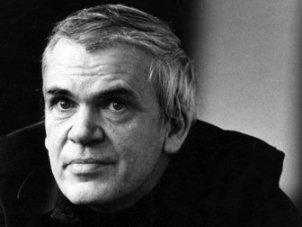
| Michael Seeger | Rezensionen | Forum |
|
|
Milan Kundera:Die UnsterblichkeitRoman, dt. München, Wien 1990 FT 12409 416 S. gelesen Dezember 1994 |
|
K. steht hier stark unter dem Einfluß des Nouveau roman. Sein Ziel ist, einen Roman zu schreiben, den man nicht erzählen kann.
Ich finde zwar, daß man ihn erzählen kann, nenne ihn aber doch lieber statt eines Romanes ein Buch. Das Allwissende hat der Autor von seinen großen europäischen Vorbildern. Mir ist er aber mehr ein Essayist, häufig ein Populärphilosoph zwei Stufen unter Sloterdijk, sehr aufschlußreich kommt er mir als erzählender Literatur/Kulturhistoriker daher. Schön sind da seine Passagen über Goethe, Bettina v. Arnim, Rimbaud, Rolland etc. Das Buch ist im besten Sinne europäisch. Diese Eigenschaft macht es mir am vertrautesten. Neben dieser großen Tradition, in die sich K. stellt und der er zweifelsohne einige Facetten hinzufügt, sind da aber auch viel Leerlauf, Redundanz, zu viele Seiten (Papierverschwendung). Das Artifiziell-Postmoderne ist eher störend. Immer wieder läßt New Age grüßen.
Sehr schön finde ich - und werde es gerne weiterverwenden: Kunderas Interpretation von Goethes „Ein Gleiches“. (S.38f):
Die Eltern des Vaters waren in Ungarn ansässige Deutsche. Der Vater hatte als junger Mann in Paris studiert, wo er passabel Französisch gelernt hatte; doch als er heiratete, sprachen die Eheleute ganz selbstverständlich deutsch miteinander. Erst nach dem Krieg erinnerte sich die Mutter der Amtssprache ihrer Eltern, und Agnes wurde aufs französische Gymnasium geschickt. Dem Vater war gerade noch ein einziges deutsches Vergnügen erlaubt: der älteren Tochter Goethes Verse im Original zu zitieren.
Es ist eines der bekanntesten deutschen Gedichte, die je geschrieben wurden, alle deutschen Kinder mußten es auswendig lernen:Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Der Gedanke des Gedichts ist einfach: im Walde schläft alles, auch du wirst schlafen. Der Sinn der Dichtung liegt jedoch nicht darin, uns durch einen überraschenden Gedanken zu verblüffen, sondern einen Augenblick des Seins unvergeßlich und einer unerträglichen Sehnsucht würdig zu machen.
Jeder Vers hat eine unterschiedliche Silbenzahl, Trochäen, Jamben und Daktylen wechseln sich ab, der sechste Vers ist merkwürdig länger als die anderen, und obwohl das Gedicht eigentlich aus zwei Vierzeilern besteht, endet der erste Satz grammatikalisch asymmetrisch mit dem fünften Vers; dadurch entsteht eine Melodie, die nie zuvor existiert hat und nur in diesem einen Gedicht auftritt, das ebenso wunderbar wie vollkommen einfach ist.
Der Vater hatte das Gedicht noch in Ungarn gelernt, als er dort die deutsche Grundschule besuchte, und Agnes hatte es zum ersten Mal von ihm gehört, als sie genauso alt war wie er damals. Sie rezitierten es auf ihren gemeinsamen Spaziergängen, und zwar so, daß sie alle Hebungen übermäßig betonten und versuchten, im Rhythmus des Gedichtes zu marschieren. Angesichts des unregelmäßigen Metrums war das gar nicht so einfach, und es gelang ihnen erst in den letzten zwei Versen: war-te nur-bal-de-ru-hest du-auch! Das letzte Wort schrien sie jeweils so laut heraus, daß es im Umkreis von einem Kilometer zu hören war: auch!
Der Vater hatte ihr das Gedicht zum letzten Mal an einem der letzten drei Tage vor seinem Tod aufgesagt. Zuerst hatte sie gedacht, er kehre auf diese Weise zur Muttersprache und zur Kindheit zurück; dann sah sie, daß er ihr vielsagend und vertrauensvoll in die Augen schaute, und es kam ihr vor, als wollte er sie an das Glück ihrer längst vergangenen Spaziergänge erinnern; erst zuletzt wurde ihr bewußt, daß diesesGedicht vom Tod sprach: ihr Vater wollte ihr sagen, daß er im Sterben lag und es wußte. Nie zuvor hatte sie daran gedacht, daß diese harmlosen kleinen Verse, die für die Schuljugend geeignet schienen, je eine solche Bedeutung haben könnten. Der Vater lag da, seine fiebrige Stirn war schweißbedeckt, und sie nahm seine Hand in die ihre; während sie mit den Tränen kämpfte, flüsterte sie zusammen mit ihm: Warte nur, balde ruhest du auch. Und sie erkannte die Stimme des nahenden Todes, des Todes des Vaters: es war die Stille schweigender Vögel in den Wipfeln der Bäume.
Was die gekünstelte Struktur des Buches anbelangt, kann ich mit der Einteilung nicht viel anfangen. Der eigentlich erzählerische Dritte Teil (Der Kampf) grenzt fast schon an Groults Banalität. Eingeräumt: So mag Intellektuellen-Existenz in Paris heute aussehen.
Mir gefallen natürlich die essayistischen Teile (2. Die Unsterblichkeit, 4. Homo sentimentalis, 5. Der Zufall) besser.Interessant ist der folgende Abschnitt über die Körperlichkeit von Mann und Frau:
Und obwohl Paul wahrscheinlich ganz besonders eitel war, machte seine Haltung dennoch den Unterschied zwischen dem Los eines Mannes und dem einer Frau sichtbar: eine Frau verbringt sehr viel mehr Zeit mit Diskussionen über ihre physischen Beschwerden; es ist ihr nicht vergönnt, ihren Körper sorglos zu vergessen. Es beginnt mit dem Schock der ersten Blutung; der Körper ist plötzlich da und die Frau sieht sich in der Rolle eines Maschinisten, der eine kleine Fabrik in Gang halten muß: täglich den Büstenhalter zuhaken, jeden Monat Tampons benutzen, Tabletten schlucken, bereit sein zur Produktion. Deshalb beneidete Agnes alte Männer; ihr schien, daß sie anders alterten: der Körper ihres Vaters hatte sich langsam in seinen eigenen Schatten verwandelt, hatte sich entmaterialisiert, war nur noch als reine, unvollkommen verkörperte Seele auf der Erde geblieben. Demgegenüber wird der Körper einer Frau immer mehr Körper, je unbrauchbarer, belastender und schwerer er wird; er gleicht einer alten, abbruchreifen Manufaktur, bei der das Ich der Frau bis zum Schluß als Wächter ausharren muß. (S. 123f)
Stark an Illitsch (Hatten Sie schonmal Zugang zu Straßburg?“), jenen Alteuropäer, erinnert mich Kunderas Betrachtung über Wege (Europa) und Straßen (Amerika): Es ist antizivilisatorisch gesprochen, gegen den Geist der Französischen Revolution, gegen dem Geist des Kapitalismus, gegen Franklins „Time is money“. Ich fühle mich durch diese Thesen stark angezogen und bestätigt, aber auch stark kritisiert, weil auch ich in meiner zweckgerichteten (Reisen, Fahren) und meiner sportlichen Fortbewegung, dem Weg keinen Selbstzweck zubillige und damit ebenfalls hybrid den Raum entwerte. Aber lesen wir den Autor selbst.
Vielleicht aber stand diese Meinung in diesem Gespräch auch nur für den ganz banalen, eifersüchtigen Kampf eines Mannes, der seine Frau endgültig ihrem Vater entreißen wollte. Denn es war der Vater gewesen, der Agnes die Natur zu lieben gelehrt hatte. Mit ihm war sie kilometerlange Wege gewandert, mit ihm hatte sie die Stille der Wälder bewundert.
Vor Jahren hatten Freunde sie durch die amerikanische Natur gefahren. Durch ein endloses, undurchdringliches Reich der Bäume, in das lange Straßen geschlagen waren. Die Stille dieser Wälder hatte für sie genauso feindselig geklungen wie der Lärm von New York. Im Wald, den Agnes liebt, verzweigen sich die Wege in kleine Wege und diese in schmale Pfade; über die Pfade wandert der Förster. Am Wegrand stehen Bänke, von denen aus man über eine Landschaft mit weidenden Schafen und Kühen sieht. Das ist Europa, das ist das Herz Europas, das sind die AlpenDepuis huit jours, j´avais déchiré mes bottines
Aux cailloux des chemins...
Acht Tage lang ließ meine Stiefel ich zerreißen.
Auf Straßenkieseln...schreibt Rimbaud.
Der Weg: ein Streifen Erde, den man zu Fuß begeht. Die Straße unterscheidet sich vom Weg nicht nur dadurch, daß man sie mit dem Auto befährt, sondern auch dadurch, daß sie nur eine Linie ist, die zwei Punkte miteinander verbindet. Die Straße an sich hat keinen Sinn; einen Sinn bekommt sie nur durch die beiden Punkte, die miteinander verbunden werden. Der Weg ist ein Lob des Raumes. Jedes Teilstück hat einen Sinn für sich und lädt zum Verweilen ein. Die Straße ist die triumphale Entwertung des Raums, der dank ihr heute nur noch Hindernis für die Fortbewegung, nur noch Zeitverlust ist.
Noch bevor die Wege aus der Landschaft verschwanden, waren sie aus der menschlichen Seele verschwunden:- der Mensch verspürt keine Sehnsucht mehr zu gehen, die eigenen Beine zu bewegen und sich daran zu erfreuen. Nicht einmal sein Leben sieht er mehr als Weg, sondern als Straße: als Linie, die von einem Punkt zum anderen führt, vom Dienstgrad des Hauptmanns zum Dienstgrad des Generals, von der Funktion der Ehefrau zur Funktion der Witwe. Die Zeit zum Leben ist für ihn zu einem bloßen Hindernis geworden, das es durch immer größere Geschwindigkeiten zu überwinden gilt.
Der Weg und die Straße verkörpern zudem zwei ganz unterschiedliche Auffassungen von Schönheit. Wenn Paul sagt, daß hier oder dort eine schöne Landschaft sei, meint er damit: wenn man dort den Wagen anhält, sieht man ein schönes Schloß aus dem 15. Jahrhundert und daneben einen Park; oder: es gibt dort einen See, über dessen glitzernden, sich in der Ferne verlierenden Spiegel die Schwäne ziehen.
In der Welt der Straßen bedeutet eine schöne Landschaft: eine Insel der Schönheit, die durch eine lange Linie mit anderen Inseln der Schönheit verbunden ist.
In der Welt der Wege ist die Schönheit dauerhaft und veränderlich; sie sagt uns bei jedem Schritt: »Verweile!«
Die Welt der Wege war die Welt des Vaters. Die Welt der Straßen war die Welt des Gatten. (S.272f)Immer wieder finden sich im Roman interessante Reflexionen über paroles, über Namen, Wörter, Bezeichnungen, Sprachen. In der Geschichte fragen wir ja immer nach Ursachen, Gründen, Anlässen, Motiven und wissen diese Kategorien zuweilen nicht zu unterscheiden. Natürlich denkt man mangels Begriffsgenauigkeit gerne an die lateinische ratio. Jetzt erzählt uns Kundera von einer Ursache, die nicht rational ist und die sich eigentlich nur im deutschen Grund findet: ganz erdig, materialistisch gemeint:
»Weshalb?« fragte Avenarius.
Ich zuckte die Schultern- »Ich kann mir für einen Selbstmord, der so fürchterlich ist wie dieser, kein Motiv, keine Ursache vorstellen, zum Beispiel eine unheilbare Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen. In einem solchen Fall würde niemand auf eine so grauenhafte Weise Schluß machen, noch dazu, wenn dabei andere mit in den Tod gerissen werden! Ein >unvernünftiges< Grauen kann es doch nur geben, wenn der Vernunft die Ursache abhanden gekommen ist. In allen Sprachen lateinischer Herkunft hat der Begriff Ursache (ratio, raison, ragione) ursprünglich einmal das bedeutet, was man heute als Vernunft bezeichnet. Die Ursache wird also immer rational verstanden. Eine Ursache, deren Rationalität nicht transparent ist, scheint keine Folgen zu haben. Das deutsche Wort Grund hat aber nichts mit dem lateinischen ratio gemeinsam und bedeutet Boden und dann auch Basis. Vom Standpunkt des lateinischen ratio aus scheint das Verhalten des auf der Straße sitzenden Mädchens absurd, unangemessen, unvernünftig, und trotzdem hat es seinen Grund. Tief in uns, in jedem von uns, ist ein solcher Grund verankert, ein Grund, der stets Ursache und Basis unserer Taten ist, auf denen unser Schicksal heranwächst. (S.288f)Unmittelbar im Anschluß an diese Passage kommt das „Outen“ des Autors über seine Schreibintension: Er wolle einen Roman schreiben, den man nicht erzählen könne. Ich muß sagen, das ist ihm mißlungen: Ich habe nämlich sehr wohl ganze Stränge des Romans schon erzählt. Kundera:
Erst nach einer Weile unterbrach Avenarius das Schweigen: »Was schreibst du jetzt eigentlich?«
»Das kann man nicht erzählen.« »Schade.«
»Überhaupt nicht schade. Es ist eine Chance. Heutzutage stürzt man sich auf alles, was -e geschrieben worden ist, um es in einen Film, eine Fernsehsendung oder einen Comic zu verwandeln. Da das Wesentliche in einem Roman aber das ist, was sich nicht anders als durch einen Roman ausdrucken läßt, bleibt in jederAdaption nur das Unwesentliche enthalten. Wenn jemand verrückt genug ist, heute noch Romane zu schreiben, muß er sie, wenn er sie schützen will, so schreiben, daß sie sich nicht adaptieren lassen, mit anderen Worten, daß man sie nicht erzählen kann.« (S.289)
Ähnlich wie hier die Differenzierung zwischen Weg und Straße oder die zwischen Ursache und Grund bringt Kundera weitere Begriffsantinomien zu Papier. Es sind dies die Stellen, die ich eingangs mit „populärphilosophisch qualifiziert habe.
Was ist der Unterschied zwischen Scham und Peinlichkeit?
.... Es würde sich schämen. Wenn der Mensch zum ersten Mal sein körperliches Ich entdeckt, ist das erste und wichtigste, was er empfindet, weder Gleichgültigkeit noch Zorn, sondern Scham: die elementare Scham, die ihn von nun an sein Leben lang begleiten wird, einmal stärker, einmal schwächer und schließlich abgestumpft von der Zeit.
Als sie sechzehn war, war sie bei Bekannten ihrer Eltern zu Gast; mitten in der Nacht bekam sie ihre Menstruation und verschmierte das Bettlaken mit Blut. Als sie es am nächsten Morgen sah, geriet sie in Panik. Sie schlich heimlich ins Badezimmer und holte einen feuchten, eingeseiften Waschlappen; doch der Fleck wurde nicht nur größer, sie beschmutzte auch noch die Matratze; sie schämte sich zu Tode.
Weshalb hat sie sich so geschämt? Es haben doch alle Frauen unter Monatsblutungen zu leiden! Hatte etwa sie sich die weiblichen Gebärorgane ausgedacht? War sie dafür verantwortlich? Nein. Nur: Verantwortlichkeit hat nichts mit Scham zu tun. Nehmen wir einmal an, Agnes hätte Tinte verschüttet und den Leuten, bei denen sie zu Gast war, den Teppich und das Tischtuch versaut; es wäre peinlich und unangenehm gewesen, aber sie hätte sich nicht geschämt. Die Grundlage der Scham ist nicht irgendein persönlicher Fehler, sondern die Schande, die Erniedrigung, die wir dafür empfinden, daß wir sein müssen, was wir sind, ohne daß wir es uns so ausgesucht haben, und es ist das unerträgliche Gefühl, daß diese Erniedrigung von überall zu sehen ist.
Man darf sich nicht wundern, daß sich das Männchen mit der langen grünen Nase für sein Gesicht schämt. Aber der Vater? Der Vater war schön gewesen! Ja, das stimmt.Und schon ist die nächste Dichotomie angerissen, nämlich die Diskriminierung von Schönheit und Häßlichkeit:.
Was aber ist Schönheit mathematisch gesehen? Schönheit bedeutet, daß ein Exemplar dem ursprünglichen Prototyp möglichst ähnlich sieht. Stellen wir uns vor, daß die minimalen und die maximalen Maße sämtlicher Körperteile in den Computer eingegeben worden sind: zwischen drei und sieben Zentimeter für die Länge der Nase, zwischen drei und acht Zentimeter für die Höhe der Stirn, und so weiter. Ein häßlicher Mensch hat eine acht Zentimeter hohe Stirn und eine nur drei Zentimeter lange Nase. Die Häßlichkeit: die poetische Launenhaftigkeit des Zufalls. Bei einem schönen Menschen hat das Spiel des Zufalls sich für ein Mittelmaß entschieden. Die Schönheit: das unpoetische Mittelmaß. In der Schönheit kommt das Un-Charakteristische, das Un-Persönliche des Gesichts noch stärker zum Vorschein als in der Häßlichkeit. Ein schöner Mensch sieht in seinem Gesicht den ursprünglichen technischen Plan, wie der Konstrukteur des Prototyps ihn gezeichnet hat, und er kann schwerlich glauben, daß das, was er sieht, irgendein originelles Ich sein soll. Also schämt er sich genauso wie das belebte Männchen mit der langen grünen Nase.
Als der Vater im Sterben lag, saß Agnes auf seinem Bettrand. Bevor er in die Endphase der Agonie eintrat, sagte er: »Schau mich nicht mehr an-, und das waren die letzten Worte, die sie aus seinem Munde vernahm, seine letzte Botschaft.
Sie gehorchte; sie senkte den Kopf und schloß die Augen, hielt aber seine Hand fest und ließ sie nicht mehr los: sie ließ ihren Vater langsam und ohne einen Blick in die Welt eingehen, in der es keine Gesichter mehr gibt.Wie so viele Bücher wird auch die „Unsterblichkeit“ ab der 300sten Seite immer öder. Zwar hat Kundera mit seinen 416 S. beinahe das von Marcel Reich-Ranicki postulierte Quorum von 500 S. für einen Roman erreicht, doch reicht die erzählerische Wucht nicht bis zum Ende.So nenne ich hier hauptsächlich nur noch die Titel:
5. Teil: Der Zufall
6. Teil: Das Zifferblatt: Hier geht es um die Stufen der Liebe bei Rubens (Stufe der Athletik, der Metaphorik usw.) Alles reichlich gesponnen, ohne dem Leser den großen Gewinn zu bringen.
7. Teil: Die Feier endet mit einem Bericht von der Männerfreundschaft des Erzählers mit dem reifenstechenden Professor Avenarius und dem Gefasel davon, daß die Welt nur noch von den Frauen eine visionäre Zukunft erwarten kann. Professor Avenarius´ Lob des Spiels erinnert einerseits an Schiller, andererseits an den Schluß von Umberto Eccos Im Namen der Rose.
Lesen wir zum Abschluß noch einmal O-Ton Kundera:
»Aber wie hast du dann alles erklärt?«
»Ich habe gar nichts erklärt. Man hat mich mangels Beweisen freigesprochen.«
»Wie das, mangels Beweisen! Und das Messer?«
»Ich leugne nicht, daß es hart war«, sagte Avenarius, und ich begriff, daß ich nichts mehr erfahren würde.
Ich schwieg eine Welle und sagte dann: »Die Autoreifen hättest du um keinen Preis zugegeben?«
Er schüttelte den Kopf.
Ich wurde von einer seltsamen Rührung überwältigt: »Du warst bereit, dich als Vergewaltiger einsperren zu lassen, nur um das Spiel nicht zu verraten ... «
Und in diesem Moment verstand ich ihn- wenn wir der Welt, die sich für wichtig hält, diese Wichtigkeit absprechen, wenn unser Lachen in dieser Welt kein Echo findet, bleibt uns nur noch eines übrig: die Welt als Ganzes zu nehmen und sie zum Gegenstand unseres Spiels zu machen; ein Spielzeug aus ihr zu machen. Avenarius spielt, und das Spiel ist für ihn in dieser Welt ohne Wichtigkeit das einzig Wichtige. Aber er weiß, daß es niemanden zum Lachen bringen wird. Als er den Ökologen seinen Vorschlag machte, hatte er niemanden zum Lachen bringen wollen. Außer sich selbst.
Ich sagte: »Du spielst mit der Welt wie ein melancholisches Kind, das kein Brüderchen hat.«
Ja, das ist die Metapher für Avenarius! Ich habe sie gesucht, seit ich ihn kenne! Endlich!
Avenarius lächelte wie ein melancholisches Kind. Dann sagte er: »Ich habe kein Brüderchen, aber ich habe dich.«
Er stand auf, ich stand ebenfalls auf, und mir schien, daß uns nach Avenarius' letzten Worten nichts anderes übrigblieb, als uns zu umarmen. ....Michael Seeger, Dezember 1994
© 2002-2022 Michael Seeger, Letzte Aktualisierung 03.01.2020